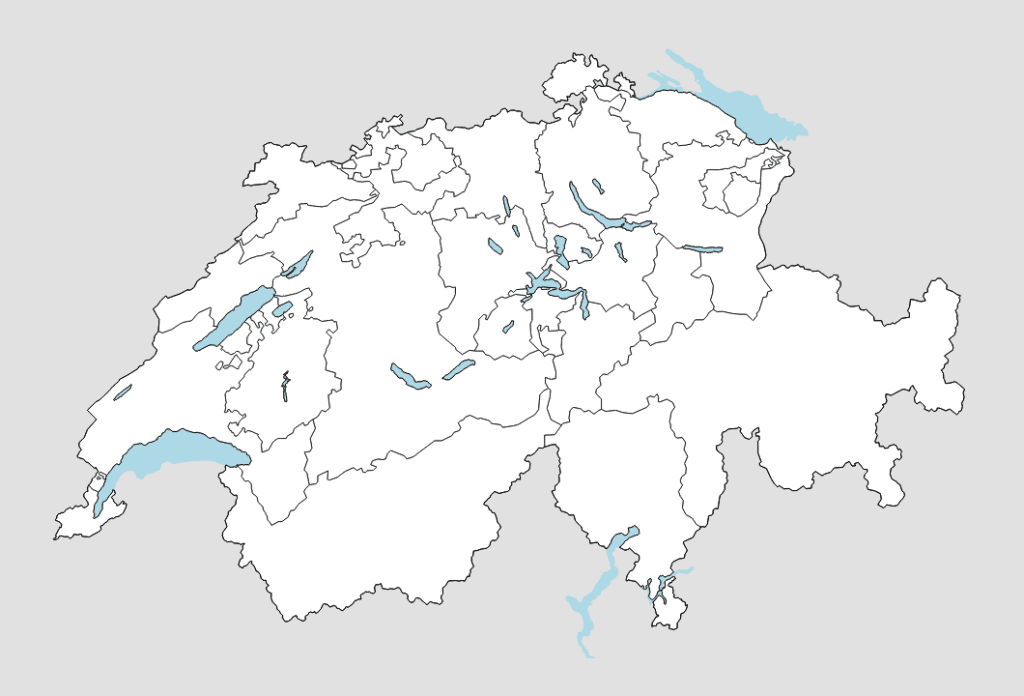Alter. Jede und jeder hat eines. Alle werden wir älter und irgendwann einmal, so Gott will, sind wir alt. Früher, als die Menschen noch nicht eine so hohe Lebenserwartung hatten wie heute, da war der Begriff «Alter» positiv besetzt. Es stand für Lebenserfahrung und Weisheit. Der Rat eines älteren Menschen zählte etwas und wurde von den jüngeren gesucht, manchmal beherzigt, manchmal abgelehnt. Aber er wurde eingeholt und erwogen. Das Wissen der Älteren war bei den «Mittelalterlichen» noch gefragt. Die Kluft zur Jugend war zwar da. Immerhin aber zollten «die Jungen» «den Alten» den Respekt, den alle Menschen verdienen und brauchen.
Alter wird schlecht gemacht
Heute ist der allgemeine Tenor ein verletzender. Heute tönt es so: «Überalterung», «die demographische Zeitbombe tickt», «Restlebenserwartung». Die deutsche Zeitschrift «Die Zeit» schrieb sogar: «Pest, Hunger und Krieg sind glücklich überwunden – nun sind die Alten da». Auch in der Amtssprache machen sich zweifelhafte Begriffe breit, zum Beispiel «pflegenahe Jahrgänge», was wohl so viel bedeutet wie gesellschaftlich abgeschrieben und ein Kostenrisiko im Gesundheitswesen. Oder «ältere Arbeitnehmer». Das ist eine Gruppe, die in Sachen Beschäftigung Probleme bereitet, da ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt abnehmen. Sie arbeiten nicht mehr so schnell, sind scheinbar weniger belastbar, nicht mehr genügend qualifiziert. Sie werden von der Wirtschaft aus dem Arbeitsprozess herauskatapultiert, von Arbeitgebern an die Luft gesetzt und ein Fall für das Sozialwesen.
Im Gassenjargon der Jugend tönt es noch krasser. Da ist die Rede von Gruftis, Zombies, Kompostis und alten Knackern. Da ist nichts mehr zu spüren von Respekt.
Selbst eine nationale Politikerin sprach schon unverblümt von «alten Säcken», als sie damit ältere Menschen meint.
Der Begriff Alter ist heute definitiv negativ besetzt. Die Sprache diente schon früher als Mittel für Ab- und Ausgrenzungen. Nun wird das Alter von der Sprache aufs Korn genommen. Teilweise passiert das ganz subtil, teilweise mit der Holzhammer-Methode: «die demografische Zeitbombe tickt», «Krieg den Alten!», «Hilfe, wir vergreisen!», «Runzelrabatt», «überaltert», «Altenlast», «Restlebenserwartung». Der Generationenkonflikt ist damit zum Kommunikationskonflikt geworden. Ältere Menschen «Schmarotzer» zu nennen, blendet aus, dass wir den heutigen Bildungs- und Wohlstand diesen Generationen zu verdanken haben.
Ein Wechsel des Blickwinkels wäre hier vielleicht mal angezeigt. Die Entwicklung, dass es immer mehr Ältere gibt, ist keine Schuldfrage. Sondern das Problem der Unterjüngung. Es gibt immer weniger jüngere Leute. Es ist schlicht eine gesellschaftliche Entwicklung, der wir uns zu stellen haben und die eine Herausforderung für uns alle darstellt.
Ausnahmen, die Profit versprechen
Einzig im Bereich Marketing sind positive Worte zu hören. Die Werbung richtet sich an das «aktive», «unabhängige», «gut situierte» und «gesunde» Alter. Wer fit ist im Alter, ist gern gesehen und erhält Lob und Komplimente. Der Grund dafür ist einleuchtend. Es gilt, auch von dieser Kaufkraft zu profitieren. Nur wer positiv umworben wird, ist kaufwillig gestimmt. Doch der positive Anschein täuscht. Er enthält den versteckten Vorwurf, dass wer im Alter krank ist, zu wenig für seine Gesundheit getan hat.
Das Kind endlich beim Namen nennen
Das Phänomen der sprachlichen Diskriminierung des Alters hat einen Namen: Ageismus. Das Wort kommt aus dem Englischen. Dort ist es seit 1969 offiziell im Gebrauch. Es umschreibt Altersfeindlichkeit als Form sozialer Diskriminierung, die negative Wahrnehmung des Alters und die damit verbundene Stigmatisierung sowohl des Älterwerdens wie auch des Alt Seins. Es beinhaltet die Schwierigkeit, die Perspektive des Alters wahrzunehmen. Umschrieben wird mit Ageismus auch die geschichtlich gewachsene, nur schwach kaschierte Abneigung oder sogar verdeckte Aggression gegen alte Menschen und die unrealistische Wahrnehmung der Lebenswelt alter Menschen. Oder um es mit den Worten von Dieter Hildebrandt zu sagen: «Im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt, aber es wird nicht gern gesehen».
Im Duden nicht auffindbar
Interessant ist, dass sich diese Altersfeindlichkeit im Duden nicht niederschlägt. Begriffe wie Alters- oder Altendiskriminierung, Ageismus tauchen nicht auf. Das lässt sich auch nicht damit erklären, dass das Wort nur im Englischen gebräuchlich ist oder eben aus dem Englischen kommt. Wörter wie Rassismus (racism) Sexismus (sexism) sind ebenfalls Anglizismen und wurden sehr rasch in den Duden aufgenommen. Es scheint, als ob Simone de Beauvoir recht gehabt hätte, als sie sagte: « Es gibt eine Verschwörung des Schweigens der Gesellschaft gegen das Alter und die Alten.» (Simone de Beauvoir, 1993).
Sprache achtsam gebrauchen
Es ist deshalb wichtig, einer korrekten Sprache wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Begriff Alter muss wieder im ursprünglichen Sinne positiv besetzt werden.
Das Wort alt kommt von alan. Das steht für nähren (aufziehen), wachsen (gewachsen, erwachsen). Es bedeutet zudem reich an Lebensjahren, längere Zeit bestehend, durch altern wertvoll geworden.
Es ist also Zeit, der sprachlichen Diskriminierung ein Ende zu setzen. Es ist Zeit, für positiv besetzte Ausdrücke. Es ist Zeit, die Kompetenz, Erfahrung und Innovationskraft auch des Alters wahrzunehmen und zu anerkennen.