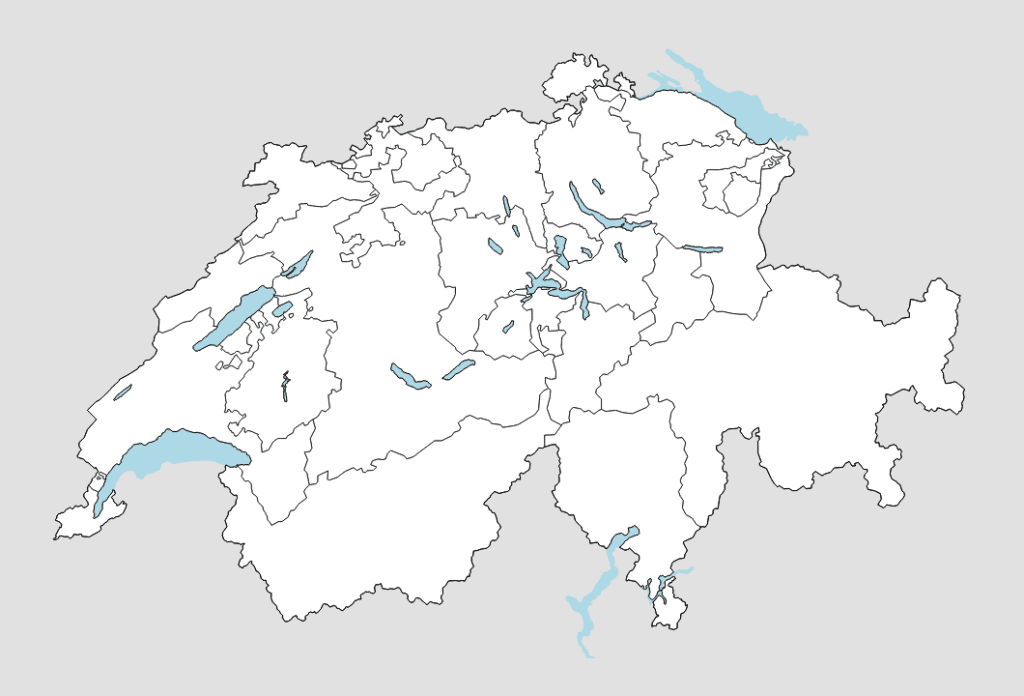Der Vorschlag des Bundesrates, Grund- und Zusatzversicherung zu trennen, ist spektakulär und greift tief ins System ein. Käme es tatsächlich zu dieser Trennung, würden sich Helsana, Groupe Mutuel und Co. aus der Grundversicherung zurückziehen und der Schritt zu einer öffentlichen Kasse wäre nur noch ein kleiner. Weshalb also wehren sich die Krankenversicherungen nicht vehementer gegen diesen bundesrätlichen Vorschlag? Ganz einfach: Weil sie darauf vertrauen können, dass ihre bürgerlichen Freundinnen und Freunde in den eidgenössischen Räten dafür sorgen werden, dass die Interessen der Versicherungen höher gewichtet werden, als die Interessen der Versicherten. So gut der Gegenvorschlag des Bundesrates ist, so wenig Chancen wird er im Kassenlobby-freundlichen Parlament haben.
Doch ist die vorgeschlagene Änderung des Krankenversicherungsgesetzes tatsächlich ein Gegenvorschlag? Etwas Staatskunde: Was ist ein direkter und was ist ein indirekter Gegenvorschlag? Ein direkter Gegenvorschlag ist ein Gegenprojekt zu einer Initiative auf Verfassungsstufe. Wie die Initiative schlägt ein direkter Gegenvorschlag also eine Verfassungsänderung vor. Verfassungsänderungen – egal ob Initiative oder Gegenvorschlag – müssen zwingend dem Volk vorgelegt werden und brauchen bei der Abstimmung nicht nur das Volks-, sondern auch das Ständemehr. Beispiel eines direkten Gegenvorschlags ist aktuell die Vorlage zur Stärkung der Hausarztmedizin. Zum direkten Gegenvorschlag des Parlaments werden sich Volk und Stände äussern müssen, auch wenn die Initiative zurückgezogen wird.
Indirekte Gegenvorschläge sind Gegenprojekte auf Gesetzesstufe. Aktuelles Beispiel ist die Änderung des Strafgesetzbuches (StGB) über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot als indirekter Gegenvorschlag zur Pädophilie-Initiative. Der Gesetzesentwurf wird nur dann zur Abstimmung kommen, wenn jemand das Referendum ergreift.
Und was ist nun die vorgeschlagene Änderung des Krankenversicherungsgesetzes, mit der die Landesregierung auf die Systemmängel des heutigen Krankenkassensystems reagiert? Ein indirekter Gegenvorschlag. Dass er es nicht so nennt, hat wohl zwei Gründe: Erstens will der Bundesrat die Bürgerlichen nicht unnötig provozieren und macht deshalb diese sprachliche Konzession. Und zweitens will er die beiden Projekte – Initiative und KVG-Änderung – zeitlich nicht miteinander verknüpfen, weil er davon ausgeht, dass die KVG-Änderungen im heutigen Parlament eh chancenlos sind.
Und dies sollte uns zurück zum Wesentlichen zurückführen und den Streit um diese semantische Beruhigungspille vergessen lassen: Mit seinen Vorschlägen bestätigt der Bundesrat die fundamentalen Systemfehler und er schlägt mit der Trennung von Grund- und Zusatzversicherung eine radikale Systemänderung vor. Die Bürgerlichen werden jedoch auch diese Vorschläge ablehnen. Ihnen sind die Interessen der Kassen viel näher als die Interessen der Versicherten und Patientinnen. Deshalb bleibt am Schluss nur eine Lösung: Ein Ja zur öffentlichen Krankenkasse. Der Entscheid des Bundesrates gibt der Initiative Legitimation. Die bockige Haltung jedoch der Bürgerlichen wird ihr Schub verleihen.