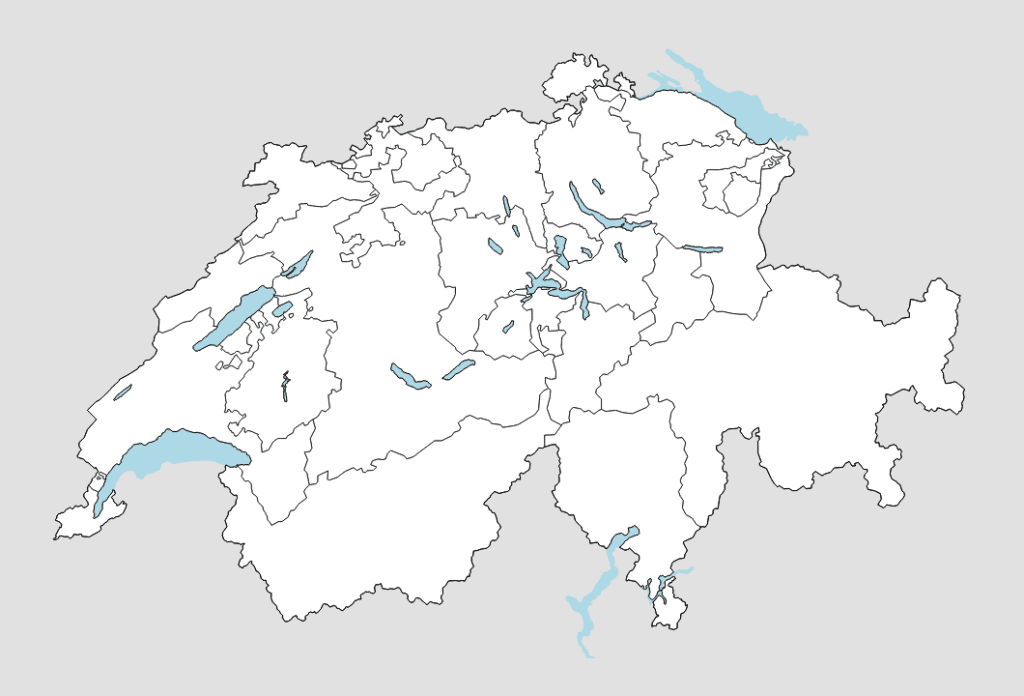Als Beispiel ist hier die Verlängerung des Impulsprogramms zur Schaffung von neuen familienergänzenden Betreuungsplätzen zu nennen, welche der Nationalrat nur mit wenigen Stimmen Unterschied beschlossen hat. Zu erwähnen ist auch, dass das Parlament im vergangenen Dezember meiner parlamentarischen Initiative gegen Homophobie zustimmte, welche ich 2013 eingereicht hatte.
Die Langsamkeit des politischen Prozesses ist auch durch das Fehlen von Statistiken zu homophober und transphober Gewalt in der Schweiz zu erklären. Der Mangel an Daten führt zu oft dazu, dass solche Gewalt gänzlich verneint oder verharmlost wird. Verschiedene Indikatoren zeigen jedoch, dass es allen Grund zur Beunruhigung gibt: Gegen LGBT+-Personen wird häufiger und gezielter Gewalt ausgeübt. Die letzten homophoben Angriffe, die in den Schlagzeilen waren, sind nur die Spitze eines Eisbergs. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die 2016 gegründete LGBT+-Helpline hat mehr als zweimal wöchentlich Fälle von homophober und/oder transphober Gewalt registriert.
Neben den krassesten Fällen körperlicher Gewalt dürfen verbale Gewalt und Belästigungen nicht vergessen gehen. Diese sind insbesondere an Schulen weit verbreitet. Das Leiden der Betroffenen ist gross. Und: Auch verbale Gewalt und Belästigungen können töten. Eine Studie der Universität Zürich zeigt, dass 20 Prozent der Homosexuellen in der Schweiz einen Selbstmordversuch unternommen haben – dies sind deutlich mehr als in der restlichen Bevölkerung. Die Hälfte dieser Suizidversuche betrifft junge Menschen unter 20 Jahren. Hinter diesen Zahlen verstecken sich menschliche Dramen und grosses Leiden. Wir dürfen nicht untätig zuschauen, wie Homophobie tötet.
Bis jetzt hat das Strafrecht jedoch homophobe Angriffe nicht als solche bezeichnet und bestraft. Diese rechtliche Lücke, die übrigens auch im Widerspruch zur Bundesverfassung steht, wurde auf internationaler Ebene bereits mehrfach moniert: durch das UN-Kinderrechtskomitee, durch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz oder auch anlässlich der regelmässigen Überprüfung der Schweiz durch den UN-Menschenrechtsrat.
Homophobie nicht mehr nur Meinung, sondern Straftat
Nach fast sechsjähriger Debatte und ebenso langem Zögern hat das Parlament nun endlich beschlossen, die Tatbestände von Artikel 261bis des Strafgesetzbuchs (Antirassismus-Strafnorm) um homophobe Hasskriminalität zu ergänzen. Ebenso wie Rassismus und Antisemitismus wird Homophobie in der Schweiz nicht mehr nur eine Meinung sein, sondern eine Straftat. Aufrufe zu Hass und Diskriminierung gegen Homosexuelle können dann endlich strafrechtlich verfolgt werden.
Leider ist es nicht gelungen, gleichzeitig den speziellen Schutz von intersexuellen und Transgender-Menschen strafrechtlich zu verankern. Und auch sonst gibt es in Bezug auf LGBT+-Rechte noch viel zu tun. Dennoch ist die Ergänzung des Strafrechts ein wichtiger Fortschritt für Tausende von Menschen in der Schweiz. Leider wird diese Errungenschaft durch das Anfang Jahr von der EDU lancierte Referendum bereits wieder in Frage gestellt. Bis Anfang April werden wir wissen, ob die extreme Rechte 50’000 Unterschriften sammeln kann, indem sie das Recht auf Beschimpfung und Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung verteidigt.
Der Kampf ist deshalb noch nicht gewonnen. Wir müssen uns bereits jetzt auf eine allfällige Abstimmungskampagne und eine gesellschaftliche Debatte rund um Homophobie vorbereiten. Leider verzögert das Referendum das Inkrafttreten der neuen Regelung. Gleichzeitig würde es der Bevölkerung ermöglichen, laut und klar ihre Unterstützung für eine Schweiz der Toleranz und der Menschenrechte kundzutun.
Auch wenn noch viel zu tun bleibt, in der Erziehung ebenso wie bei der Sensibilisierung der Bevölkerung, stellt die Ergänzung des Strafrechts ein starkes Signal dar. Die neue Regelung setzt eine klare Grenze und trägt dazu bei, dass das Strafrecht seine Rolle beim Schutz von Minderheiten und für das Recht auf Verschiedenheit erfüllt. Homophobe Beschimpfungen und Angriffe werden in der Schweiz nicht länger toleriert.